Digitalisierungsinitiative II

Im Editorial des Kammerreports 4/2024 vom 29. August des vergangenen Jahres – also vor genau einem Jahr – habe ich Ihnen von der Digitalisierungsinitiative der Justiz von Bund und Ländern berichtet. Zu den zentralen Vorhaben des Bundes zählten die Konzeption einer bundeseinheitlichen Justizcloud, die Pilotierung eines zivilgerichtlichen Online-Verfahrens, die Entwicklung einer Digitalen Rechtsantragsstelle, die Realisierung eines einheitlichen Rechtsinformationsportals, eines Videoportals der Justiz und einer Vollstreckungsdatenbank zur papierlosen Zwangsvollstreckung. Die Förderung von Vorhaben der Länder umfasst u.a. die Einführung eines gemeinsamen Fachverfahrens für die Justiz, die weitere Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs (u.a. Weiterentwicklung des Datenaustauschformats XJustiz und SAFE-Verzeichnisdienst; Visualisierungswerkzeuge für XJustiz-Datensätze), die Strukturierung von Justiz-Verfahrensakten mit Hilfe von KI und KI-Apps, die Entwicklung einer KI-Strategie und KI-Plattform, eine maschinelle Übersetzungsplattform der Justiz, die Entwicklung eines generativen Sprachmodells der Justiz und vieles andere mehr.
Nun, so richtig vorangekommen ist man offensichtlich noch nicht. Der Mehrwert des in der Testphase befindlichen Rechtsinformationsportals des BMJV (https://testphase.rechtsinformationen.bund.de) scheint überschaubar, ebenso wie jener der digitalen Rechtsantragsstelle (https://www.bmjv.de/DE/themen/digitales/digitalisierung_justiz/digitalisierungsinitiative/_articles/digitale_rechtsantragstelle_artikel.html). Der im vergangenen Jahr vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit fiel nach dem Scheitern der Ampelkoalition der Diskontinuität anheim und wurde nun neu aufgelegt (https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0371-25.pdf). Zwischenzeitlich hatte das BMJV bereits mit den Arbeiten an der technischen Ausgestaltung des Online-Verfahrens begonnen, leider ohne die verfasste Anwaltschaft von Anbeginn an einzubeziehen. Es scheint, als habe man zunächst einen „Jugend forscht“-Ansatz verfolgt, der zudem eher die Interessen von Fluggastrechte-Inkassoportalen und Fluggesellschaften berücksichtigt, als jene der Anwaltschaft. Einige wenige Kanzleien will man befragt haben, wonach genau, ist unklar. Nun, das BMJV scheint umgeschwenkt zu haben; jedenfalls fordert das BMJV jetzt Mitwirkungsleistungen der BRAK ein, zumal die Anwaltschaft an das Onlineportal über den beA-Identity Provider angebunden werden soll. Als zuständiger BRAK-Vizepräsident werde ich darauf drängen, dass das BMJV die Anwaltschaft nicht nur als Lieferanten einzelner IT-Komponenten in Anspruch nimmt, sondern als Kooperationspartner hinreichend ernst nimmt. Schließlich werden die weitaus meisten Fälle vor den Amtsgerichten, die an das Online-Verfahren angebunden werden sollen, von anwaltlich vertretenen Parteien geführt. Es wäre daher schlicht inakzeptabel, bei der technischen Entwicklung des Verfahrens vorrangig auf die Interessen der mit Fluggastrechtsstreitigkeiten befassten Inkassodienstleister und Fluggesellschaften abzustellen, auch wenn das Verfahren zunächst mit derlei Streitigkeiten erprobt werden soll (https://www.bmjv.de/DE/themen/kaufen_reisen_wohnen/flugreisen/flugreisen_node.html).
Ebenfalls der Diskontinuität anheimgefallen und nun als Referentenentwurf neu aufgelegt worden ist der Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_Digitalisierung_Zwangsvollstreckung.html). Es ist ein überfälliges Gesetz. Schließlich endet die dringend notwendige Digitalisierung gerichtlicher Verfahren nicht mit dem Urteil, sondern muss auch im Bereich der Vollstreckung vorangetrieben werden, um auf Papier verkörperte Vollstreckungstitel, Vollstreckungsanträge oder weitere Korrespondenz insbesondere mit Gerichtsvollziehern entbehrlich werden zu lassen. Leider versäumt allerdings auch der neu aufgelegte Gesetzentwurf, Medienbrüche vollständig durch die Schaffung eines digitalen Vollstreckungsregisters zu vermeiden, wie sie auch die Reformkommission Zivilprozess der Zukunft, der ich angehören durfte, gefordert hat (zum Abschlussbericht: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/250131_Abschlussbericht_Zivilprozess_Zukunft.pdf?__blob=publicationFile&v=3). Dieses Versäumnis kritisiert die BRAK in ihrer Stellungnahme 32/2025 zu Recht (https://intranet.brak.de/seiten/pdf/BRAKNr/2025/2025_247Anlage1.pdf). Etwas Zuversicht lässt sich nur aus dem gegenüber dem Entwurf aus 2023/2024 geänderten Abschnitt „C. Alternativen“ des aktuellen Referentenentwurfs schöpfen. Danach sei „mittelfristig“ zur Behebung der Problematik hybrider Anträge und Aufträge eine digitale Lösung angestrebt, die vor allem aus Gründen des Schuldnerschutzes ein hohes Niveau an Fälschungs- und Manipulationsschutz gewährleisten könne und das Verfahren vereinfache. Eine solche Lösung werde voraussichtlich in der Schaffung einer elektronischen Datenbank für die Zwangsvollstreckung bestehen, zu der Vorarbeiten bereits begonnen hätten. Bis zur Realisierung der notwendigen technischen Entwicklungen könne auf eine Übergangslösung nicht verzichtet werden. Diese werde voraussichtlich auch zumindest für eine gewisse Zeit für die Zwangsvollstreckung auf der Grundlage zuvor ausgestellter vollstreckbarer Ausfertigungen erforderlich sein. Nun, es bleibt zu hoffen, dass die Vorarbeiten zur Schaffung eines elektronischen Vollstreckungsregisters zügig voranschreiten und sodann die nötigen weiteren gesetzgeberischen Schritte zur vollständigen Digitalisierung des Zwangsvollstreckungsverfahrens ermöglichen. Zweifel sind angebracht.
Ein Trauerspiel schließlich ist der vom BMJV vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_E-Akten-Gesetz.html). 10 Jahre hatten die Bundesländer Zeit, die E-Akte in der Justiz einzuführen – und nein, es ist nicht gelungen, die E-Akte flächendeckend einzuführen. Daher sollen die Länder nun ein optionales weiteres Jahr erhalten. Ob es reicht? Bereits in meinem Editorial vom August vergangenen Jahres hatte ich prognostiziert, dass es das eine oder andere Gericht nicht schaffen würde, die am 1.1.2026 ablaufende Frist zur Einführung der E-Akte zu wahren und daran erinnert, dass bei Inkrafttreten der gesetzlichen Frist geborene Kinder heute mit dem iPad lernen. Ich bin auch jetzt pessimistisch, wobei es keinesfalls Vergnügen bereitet, im Nachhinein sagen zu können, man habe ja Recht gehabt. Und es ist auch nicht vergnüglich, erneut darauf hinweisen zu müssen, dass der Anwaltschaft zwischen Verkündung des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013, welches die BRAK zur Einrichtung des beA verpflichtete und dessen (passive) Nutzungspflicht zum 1.1.2018 begründete, weit weniger Zeit zur Verfügung stand, die Voraussetzungen für den elektronischen Rechtsverkehr zu schaffen. Schon seit dem 1.1.2022, d.h. seit bald 4 Jahren trifft die Anwaltschaft im Übrigen die „aktive“ Nutzungspflicht. Die Gerichte hingegen versenden weiterhin Papier, und das nun noch länger. Dabei ist doch die E-Akte noch gar keine wirkliche „Digitalisierung“!
Zu guter Letzt: Die Digitalisierungsdefizite im Bereich der Justiz dürften in besonderem Maße Grund für die Überlastung Hamburger Gerichte sein, insbesondere des Amtsgerichts. Die dortigen Verhältnisse musste ich wiederholt an dieser Stelle kritisieren. Für die Verfahrensbeteiligten und sonstige „Kundschaft“ des Amtsgerichts wesentliche Verbesserungen sind nicht recht ersichtlich. Und nun erscheinen auch noch die aktuellen Berichte des Statistischen Bundesamts zum Bereich Justiz und Rechtspflege 2024 (https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/_publikationen-innen-statistischer-bericht.html). Um die Hamburger Justiz steht es danach nicht besonders gut. Ein Beispiel: Die durchschnittliche Dauer der amtsgerichtlichen Verfahren in Zivilsachen, die mit streitigem Urteil endeten, betrug im vergangenen Jahr in Hamburg 10,9 Monate, im Bundesdurchschnitt 8,8 Monate und – den Hamburger schmerzt es – im OLG-Bezirk München gar nur 6,6 Monate. Gegenüber der letzten Statistik aus 2021 ist dies eine nicht unerhebliche Verschlechterung Hamburgs (2021: 9,1 Monate), während es im Bundesschnitt nur eine leichte Verschlechterung gab (2021: 8,7 Monate) und, wiederum schmerzhaft, eine deutliche Verbesserung Münchens (2021: 7,0 Monate). Und nun soll der amtsgerichtliche Zuständigkeitsstreitwert von EUR 5.000,00 auf EUR 10.000,00 deutlich heraufgesetzt werden (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_Zustaendigkeitsstreitwert.html). Für die Anhebung des amtsgerichtlichen Zuständigkeitsstreitwertes, für die sich Hamburg bereits in der Justizministerkonferenz 2023 eingesetzt hat (seinerzeit ging es noch um eine Anhebung auf EUR 8.000,00, Beschluss zu Top I.3, JuMiKo v. 25./26.05.2023), mag es gute Gründe geben, insbesondere die Förderung der Amtsgerichte in den Flächenstaaten. Gleichwohl ist die Anhebung nicht unproblematisch (hierzu BRAK-Stellungn. 25/2025, https://www.brak.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2025/stellungnahme-der-brak-2025-25.pdf). Was es für Hamburg bedeutet, wenn auf das Amtsgericht jährlich mehrere tausend zusätzliche Fälle zukommen, mag man sich nicht ausmalen. Der Hamburger Kammervorstand wird die weiteren Entwicklungen sehr kritisch verfolgen.
Ihr
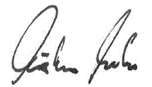
Dr. Christian Lemke
Präsident

